
Schweizer Sonderweg bei Radsatzprüfungen: VPI warnt
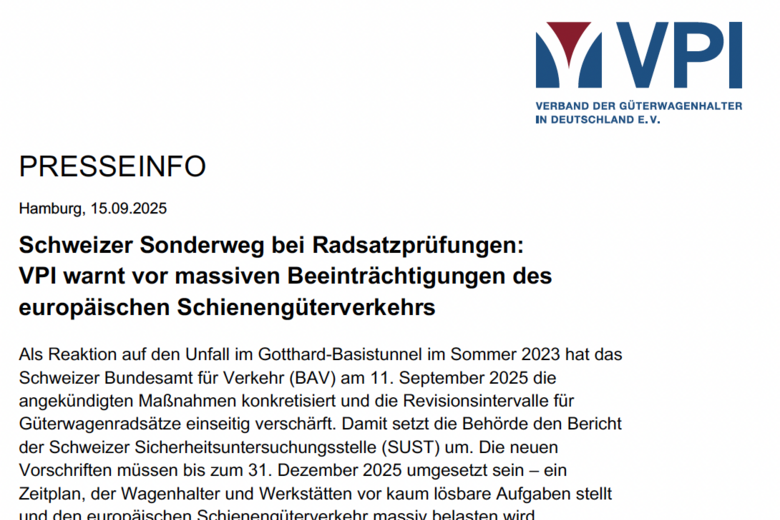
Als Reaktion auf den Unfall im Gotthard-Basistunnel im Sommer 2023 hat das Schweizer Bundesamt für Verkehr (BAV) am 11. September 2025 die angekündigten Maßnahmen konkretisiert und die Revisionsintervalle für Güterwagenradsätze einseitig verschärft. Damit setzt die Behörde den Bericht der Schweizer Sicherheitsuntersuchungsstelle (SUST) um. Die neuen Vorschriften müssen bis zum 31. Dezember 2025 umgesetzt sein – ein Zeitplan, der Wagenhalter und Werkstätten vor kaum lösbare Aufgaben stellt und den europäischen Schienengüterverkehr massiv belasten wird.
Klar ist: Verhältnismäßigkeit, Tragbarkeit und Umsetzbarkeit der vom BAV beschlossenen Maßnahmen sind nicht gegeben. Es drohen enorme wirtschaftliche Schäden für den Schienengüterverkehr auf Europas wichtigstem internationalen Korridor. Der umweltfreundlichste Verkehrsträger darf nicht geschwächt werden – er ist zentral für die Verkehrswende und ein wirksamer Hebel für den Klimaschutz.
„Sicherheit ist unser oberstes Anliegen. Aber sie darf kein Thema für nationale Alleingänge sein“, betont VPI-Vorsitzender Malte Lawrenz. Nur im europäischen Rahmen ließen sich praktikable und wirksame Maßnahmen entwickeln, die Sicherheit und Interoperabilität gleichermaßen gewährleisten. „Wir brauchen hier europäische Einheit statt Insellösungen“, mahnt Lawrenz.
Wagenhalter einseitig im Fokus
Die Verfügung des BAV trifft vor allem die Wagenhalter. Sie sollen mit drastisch verkürzten Instandhaltungsintervallen die Hauptlast tragen, während Eisenbahnverkehrsunternehmen und Infrastrukturbetreiber weitgehend verschont bleiben. Dabei gilt: Sicherheit ist eine gemeinsame Verantwortung – alle Akteure im Schienengüterverkehr müssen gleichermaßen in die Pflicht genommen werden.
Bruch mit europäischen Verfahren
Mit den Sondervorschriften setzt sich das BAV über die Ergebnisse des von der Europäischen Eisenbahnagentur (ERA) eingesetzten „Joint Network Secretariat“ (JNS) hinweg. Die dort entwickelten Maßnahmen liegen seit Juli 2024 vor. Statt diese Verfahren zu respektieren, hat die Schweiz eine Insellösung verordnet, die die Interoperabilität gefährdet.
Umsetzung unrealistisch – Versorgung gefährdet
Die Maßnahmen erschüttern den Schienengüterverkehr in seinen Grundfesten. Es ist weder für Wagenhalter noch für Werkstätten absehbar, wie sie die Anforderungen in der Kürze der Zeit erfüllen sollen. Weder der Aufbau zusätzlicher Werkstattkapazitäten noch das Vorhalten einer „schweizfähigen“ Wagenflotte sind bis Ende des Jahres realisierbar. Die Folge: drastische Engpässe in der Transportlogistik, Einschränkungen im freien Wagenverkehr und Risiken für die Versorgungssicherheit.
Wirtschaftliche Belastung und Rückschlag für Innovation
Die zusätzlichen Kosten summieren sich auf dreistellige Millionenbeträge jährlich. Sie schwächen die Wettbewerbsfähigkeit der Schiene gegenüber der Straße und entziehen den Wagenhaltern die Mittel, die dringend für Zukunftsinvestitionen gebraucht werden – etwa für Digitalisierung, Automatisierung und die Einführung der Digitalen Automatischen Kupplung (DAK).
„Es wäre paradox, wenn Maßnahmen im Namen der Sicherheit genau jene Innovationen ausbremsen, die Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit langfristig erhöhen“, so Lawrenz.
Der VPI schließt sich den Positionen seines europäischen Dachverbandes UIP (www.uiprail.org) und des Schweizer Wagenhalterverbandes VAP (www.cargorail.ch) an. Alle drei Verbände fordern ein abgestimmtes, verhältnismäßiges Vorgehen auf europäischer Ebene.
Ihr Pressekontakt
